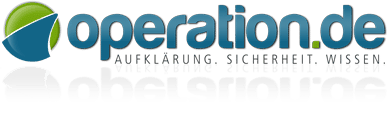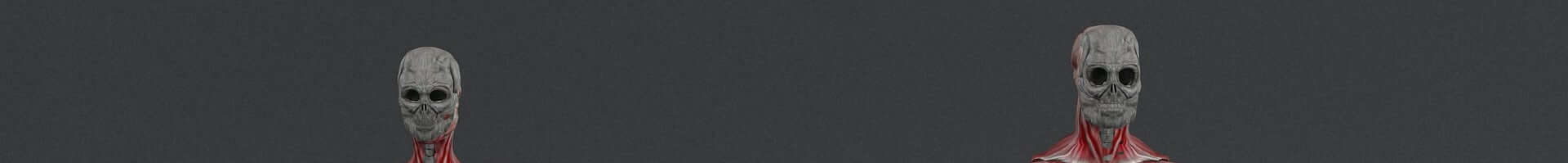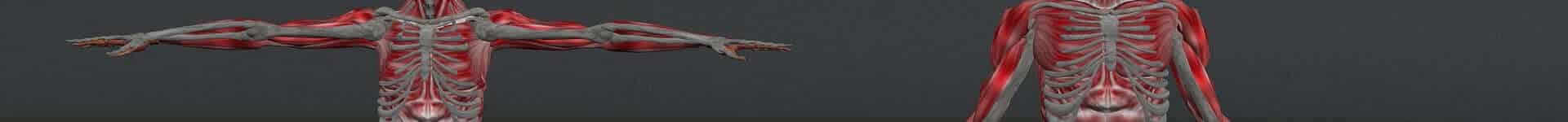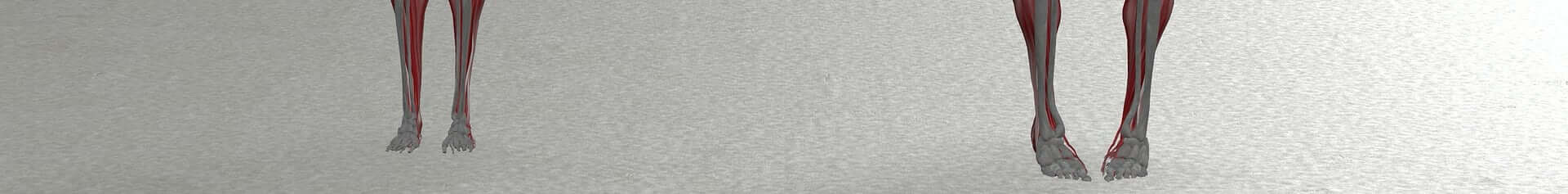Kniegelenk Schlittenprothese – die Risiken
Risiken der Operation: Falls die Operation in Vollnarkose durchgeführt wird, gelten hierfür die üblichen Risikofaktoren, welche durch den Anästhesisten vorab erörtert werden. Erhöhte Risikofaktoren können hier vor allem bei Patienten mit schwerwiegenden Kreislauf- und Herzerkrankungen bestehen. Deshalb sollten in den Monaten vor der Operation keine Herzinfarkte oder Schlaganfälle aufgetreten sein. Die Operationsfähigkeit wird durch den Narkosearzt festgelegt. Hierfür sind meist zusätzliche Untersuchungen, wie z.B. ein EKG (Echokardiogramm) oder Laboruntersuchungen des Blutes, notwendig.
Alternativ zur Vollnarkose kann auch eine Spinalanästhesie zum Einsatz kommen. Hierbei wird durch einen Katheter am Rückenmark das zu operierende Bein betäubt. Wie bei allen invasiven Verfahren kann es auch hier in seltenen Fällen zu Komplikationen (wie Infektionen oder Hämatome im Bereich des Rückenmarks) kommen, welche eine operative Versorgung notwendig machen. Welches Narkoseverfahren verwendet wird, bestimmt der Narkosearzt in Absprache mit dem Patienten.
Die Implantation einer Schlittenprothese beinhaltet zudem noch spezielle Risiken, über welche der Operateur den Patienten vorab ausführlich aufklären muss. Schwerwiegende Risiken sind vor allem Wundheilungsstörungen und Infektionen, da hierdurch im Verlauf weitere Operationen notwendig werden können.
Als weiterer Punkt kommt es wie bereits erwähnt mit den Jahren zu einer Lockerung der Prothese oder einem weiteren Verschleiß der restlichen Gelenkanteile, welche beide einen Wechsel zumeist auf eine Totalendoprothese erforderlich machen. Sehr selten kann es auch während der Operation zu Knochenbrüchen (besonders am oberen Schienbeinanteil) sowie zu Gefäß- und Nervenschäden kommen. Auch wenn in der Regel die Beweglichkeit mit dieser Prothese sehr gut ist, so kann es in Einzelfällen doch zu Bewegungseinschränkung und anhaltenden Schmerzen kommen. Bei Schlittenprothesen mit beweglichem Inlay kann es vor allem bei instabilen Bändern zu einer Luxation (einem „Herausspringen“) dieses Prothesenanteils kommen. Auch dieses Ereignis tritt selten ein und macht eine weitere Operation erforderlich.